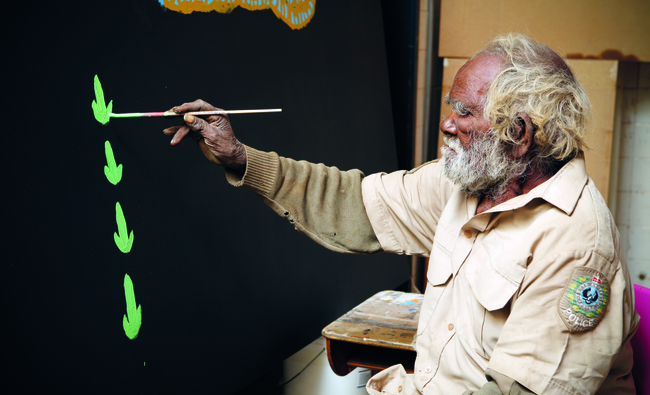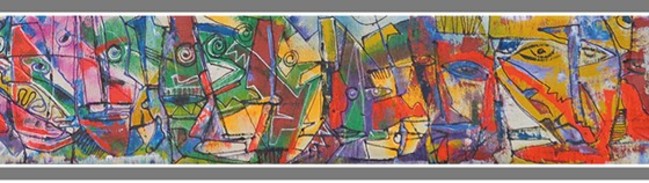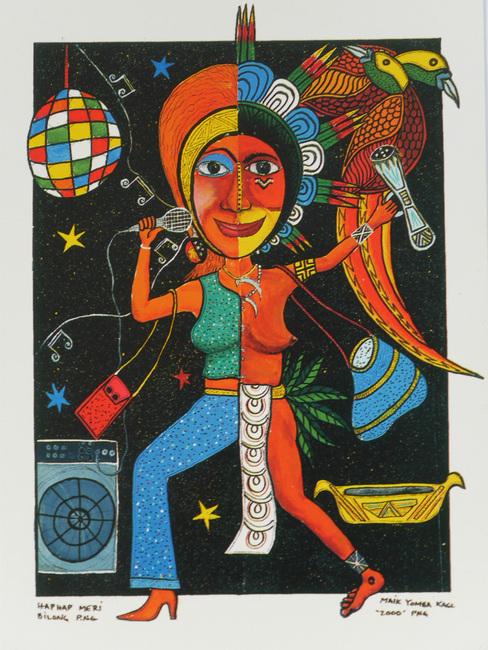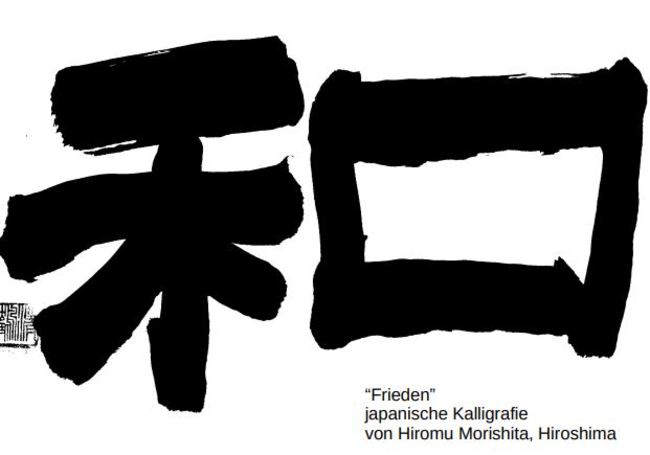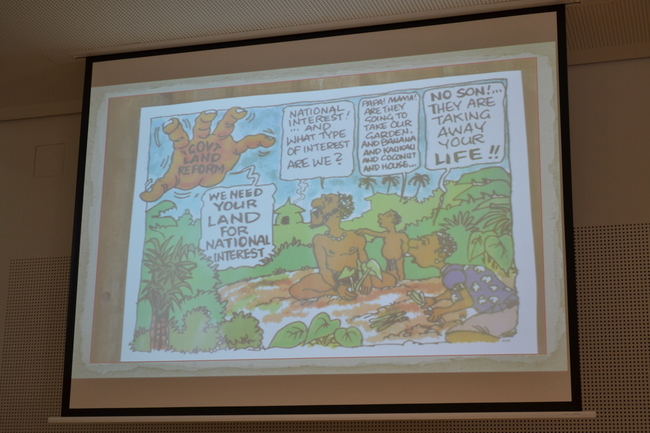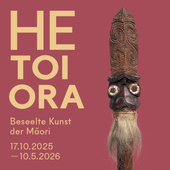|
KIRCHLICHE
NACHRICHTEN
Papua - Neuguinea
Pazifik
PNG: REGIERUNG
WIDERRUFT ANERKENNUNG TAIWANS
Ende Juli hat
der neugewählte Regierungschef von Papua-Neuguinea, Sir Mekere
Morauta, die von seinem Vorgänger Anfang des Monats in die
Wege geleitete diplomatische Anerkennung Taiwans widerrufen. Morautas
Vorgänger Bill Skate hatte wegen der herrschenden Wirtschaftskrise
im Land Taiwan um finanzielle Unterstützung gebeten. Im Gegenzug
versprach Skate, die Inselrepublik diplomatisch anzuerkennen.
Dieser Schritt hatte in China und Australien heftigen Protest ausgelöst.
China drohte mit Sanktionen, und Australien übte indirekt Druck
auf Skate aus. Auch der Internationale Währungsfonds und die
Weltbank, zwei für den Wiederaufbau der Wirtschaft Papua-Neuguineas
unentbehrliche Institutionen, übten ebenfalls heftige Kritik.
Eine Woche nach der umstrittenen und zunächst unter grosser
Geheimhaltung erfolgten Aktion trat Skate zurück.
Seit seinem Amtsantritt stand Morauta Mekere unter grossem Druck,
die vorhandenen
Spannungen mit Peking zu entschärfen. Knapp zwei Wochen nach
Skates Aufenthalt
in Taipeh erklärte er, dass sich sein Vorgänger nicht
an das im Kabinett vereinbarte Vorgehen gehalten habe. Er
sei nicht berechtigt gewesen,
ein Abkommen zu unterzeichnen, sondern habe lediglich den Auftrag
gehabt, über
die Bedingungen, die zu einem Abkommen führen könnten,
zu verhandeln.
Aus diesem Grund entbehre die diplomatische Anerkennung Taiwans
jeder rechtlichen
Grundlage. Mit dieser Erklärung verstand es Mekere,
gegenüber
Taiwan das Gesicht zu wahren und gleichzeitig eine Annäherung
an Taipeh
zu einem späteren Zeitpunkt nicht auszuschliessen.
(Independent 22.07.99; NZZ 22.07.99)
INHALT
PNG:
LAND BENÖTIGT KREDITE IN HÖHE VON 600 MILLIONEN DOLLAR
Mit Kreditleistungen
in Höhe von rund 600 Millionen Dollar will die Regierung
Papua-Neuguineas der Wirtschaft des Landes zum Aufschwung
verhelfen und
damit auch dem weiteren Verfall der Landeswährung Kina (0,64
DM je Kina am
20.09.99) entgegenwirken. Als ersten Schritt zur Stabilisierung
der Wirtschaft hat die Regierung im August eine Korrektur des
laufenden Haushalts
vorgenommen.
Wie Vertreter des Internationalen Währungsfonds (IWF) nach
einem einwöchigen Aufenthalt
in Papua-Neuguinea erklärten, seien für die gegenwärtige
Misere des
Landes insbesondere der Preisverfall für wichtige Exportgüter,
die Lockerung
von Fiskal- und Geldpolitik unter der vorhergehenden Regierung
sowie der Verlust
von Transparenz in politischer Entscheidungsfindung verantwortlich.
Ein multilaterales Finanzierungsmodell soll künftig - zusammen
mit umfangreichen
strukturellen Veränderungen - zur Stabilisierung der
Wirtschaft beitragen
und die Grundlage für den Jahreshaushalt 2000 schaffen.
Veränderungen struktureller Art könnten, so Premierminister
Morauta, den Bereich
Privatisierung betreffen sowie Reformen im öffentlichen Bereich,
im Finanzsektor
u.a. betreffen. Neben der erhofften finanziellen Unterstützung
von seiten der
asiatisch-pazifischen Nachbarländer sowie des IWF und der
Weltbank will
die Regierung auch westliche Geberländer um Hilfe ersuchen.
Bereits im August hat Premierminister Morauta die ins Stocken geratenen
Verhandlungen
mit Vertretern der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds
(IWF) wieder aufgenommen.
(PIR 18. & 19.08.99; Independent 12. & 19.08.99)
INHALT
PNG:
BUNDESREPUBLIK SCHLIESST DIPLOMATISCHE VERTRETUNG IN PORT MORESBY
Das Auswärtige
Amt hat Ende Juli die Schliessung von insgesamt 20 diplomatischen
Vertretungen bekannt gegeben. Betroffen von dieser Entscheidung
ist auch die deutsche Vertretung in Port Moresby. In einer
Presseerklärung
macht das Ministerium die Sparpläne der Bundesregierung für
diesen Schritt
verantwortlich. Demnach muß das Auswärtige Amt im Haushalt
2000 rund 270
Millionen Mark einsparen.
Im Zuge der Sparmaßnahmen sollen insgesamt fünf Botschaften,
zwölf Generalkonsulate
und drei Aussenstellen geschlossen werden. Damit handelt es
sich um fast
zehn Prozent der insgesamt 230 deutschen Vertretungen im
Ausland. Neben
Papua-Neuguinea sind Staaten wie Burundi, Sierra Leone, Niger
und Tschad von
diesem Schritt betroffen.
(SZ 23.07.99; PIR 19.08.99)
INHALT
PNG:
OTML BESTÄTIGT VERHEERENDE UMWELTSCHÄDEN DURCH DEN OK-TEDI-MINENBETRIEB
Wie bereits
gemeldet, erwägt das Bergbaukonsortium Ok Tedi Mining Limited
(OTML) aufgrund
einer aktuellen Umweltstudie, die Ok-Tedi-Mine eventuell
vorzeitig zu
schließen. Im Juni hatte Managing Director Roger Higgins
erklärt,
dass die Studie eine Belastung der Umwelt durch den Minenbetrieb
belege, die um
ein Vielfaches höher liege als bisher angenommen. An dieser
Tatsache könnten
auch die von OTML vorgesehenen Umweltmassnahmen nur wenig
ändern.
Weder das geplante Ausbaggern des Flussbettes noch die Lagerung
von Abraum
an anderer Stelle können laut Studie eine wirkliche Lösung
der Umweltprobleme
darstellen. Im Gegenteil: Eine Lagerung von Abraum im
Mittelbereich des Ok-Tedi-Flusses beinhalte aufgrund von Landrechtsfragen
ein weiteres Spannungs- und Konfliktpotential.
Inzwischen wird offen darüber spekuliert, wie es zu diesem
plötzlichen Sinneswandel
des Konsortiums gekommen ist. Handelt es sich bei der vorzeitigen
Schliessung um einen "eleganten" Ausweg aus der gesamten
Umweltmisere?
Eines ist jedenfalls sicher: Eine vorzeitige Schliessung der
Mine hätte
ernste Folgen für die Wirtschaft des Landes und das Wohlergehen
der Western Province.
Die Mine erwirtschaftet 20 Prozent der Exporterlöse
des Landes. Zur gesamtwirtschaftlichen Leistung Papua-Neuguineas
steuert Ok
Tedi rund zehn Prozent bei. Noch im Vorjahr wurden 13 Tonnen Gold,
26 Tonnen
Silber und 150.000 Tonnen Kupfer gewonnen. Der Staat ist zum einen
indirekt über
Förderabgaben, zum anderen direkt mit 30 Prozent am Bergwerk
beteiligt.
Offiziellen Angaben zufolge sollen sich die Kosten für eine
vorzeitige Schliessung
auf rund 250 Millionen Dollar belaufen.
(The National 12.08.99; PC 16., 20. & 24.08.99; PIR 24.08.99;
FR 26.08.99)
INHALT
BOUGAINVILLE:
REFERENDUM ÜBER DIE POLITISCHE ZUKUNFT DER INSEL GEFORDERT
Joseph Kabui,
Chef der Interimsregierung auf Bougainville (sog. "Bougainville
People`s Congress"), hat Anfang September ein Referendum für
seine Insel gefordert.
Kabui wandte sich an die Zentralregierung in Port Moresby
und forderte eine klare Stellungnahme des Premierministers. Im Juli
dieses Jahres
hatte der damalige Premierminister Skate ein Referendum über
einen erweiterten
Autonomiestatus der Insel, nicht aber deren Unabhängigkeit
in Aussicht gestellt.
Der Bevölkerung Bougainvilles müsse das demokratische
Recht gewährt werden,
die politische Zukunft der Insel selbst zu bestimmen, betonte Kabui.
Wie diese
Zukunft aussehen möge, ob grösstmögliche Autonomie
oder gar Unabhängigkeit,
stehe noch offen. Die Einrichtung einer Provinzregierung
werde aber in
keinem Falle akzeptiert. Nach Ansicht Kabuis müsse eine
vollkommen neue
und von der Bevölkerung bestimmte politische Ordnung
geschaffen werden.
Wie Kabui weiter meinte, sei das Abhalten eines Referendum jedoch
frühestens in
zwei, drei Jahren möglich. Zunächst müssten verfassungsrechtliche
Grundlagen geschaffen
und politische Aufklärungsarbeit vor Ort geleistet werden.
(The National 06.09.99; PNB September 99)
INHALT
OSTTIMOR:
ENTSCHEIDUNG FÜR DIE UNABHÄNGIGKEIT VON INDONESIEN ZIEHT
GEWALT UND TERROR NACH SICH
Bei dem am 30.
August unter UN-Aufsicht durchgeführten Referendum über
die politische
Zukunft Osttimors haben sich 78,5 Prozent der mehr als 450.000
Abstimmenden
für die Unabhängigkeit des Territoriums ausgesprochen.
Nur 21,5 Prozent
votierten für den Verbleib des seit 1975 von Indonesien besetzten
Inselteils im
indonesischen Staatenbund.
Während der Urnengang weitgehend friedlich und fair verlaufen
war, eskalierte
drei Tage später auf dem gesamten Inselteil erneut die Gewalt
zwischen nabhängigkeitsbefürwortern
und -gegnern. Etwa 2.000 Milizen griffen
das Hauptquartier der UN-Mission in der Hauptstadt Dili an und
bedrohten mit
automatischen Waffen UN-Angehörige und journalisten. Mehrere
Häuser in
der Nähe des UN-Quartiers gingen in Flammen auf. Auch aus anderen
Städten
kamen Berichte von Übergriffen und Morden durch paramilitärische
Gruppen. Terror und Gewalt erreichten in den darauf folgenden Tagen
und Wochen
ein bis dahin unvorstellbares Ausmass. Die blutige Jagd auf
Befürworter
der Unabhängigkeit und rund 4.000 einheimische Angestellte
der UN-Mission
kannte keine Grenzen. Paramilitärische Banden zogen über
das Land,
plünderten, vergewaltigten, brandschatzten und töteten
und brachten das
gesamte Territorium unter ihre Kontrolle.
Indonesisches Militär und Polizeikräfte schauten weitgehend
untätig zu und unterstützten
sogar die Milizen beim Errichten ihres Terrorregimes. Mehrere
hunderttausend
Menschen flüchteten in die Berge oder verliessen das
Territorium per
Schiff und Flugzeug. Auch UN-Personal, Mitarbeiter internationaler
Hilfsorganisationen sowie ausländische Journalisten waren
wenig später
evakuiert worden.
Jakarta reagierte zunächst mit der Entsendung weiterer Spezialeinheiten
der Polizei,
stockte das ohnehin bereits mehrere tausend Mann zählende
Kontingent an
Polizeikräften und Militärs auf. Den Forderungen von seiten
des Auslands
nach Entsendung einer UN-Friedenstruppe kam Jakarta nur zögerlich
nach. Erst am 12. September hat die indonesische Regierung dem
wachsenden internationalen
Druck nachgegeben und der Entsendung einer bewaffneten
UN-Truppe zugestimmt.
Am 19. September landete ein Vorauskommando der Osttimor-Friedenstruppe
(Interfet) in
Dili. Der Einmarsch der später etwa 7.500 Soldaten starken
internationalen
Streitmacht begann am darauf folgenden Tag. Rund 2.000 australische
Soldaten bilden den Grossteil der Friedenstruppe, gefolgt von
rund 1.500 Soldaten
aus Thailand. Sie werden von 250 britisch-nepalesischen Gurkhas
sowie von kleineren Armee-Einheiten anderer Staaten begleitet.
Oberbefehlshaber
der Truppe ist der australische Generalmajor Peter Cosgrove.
Trotz Zwischenfällen wertete die Interfet die erste Woche ihres
Einsatzes als
Erfolg. Nach einer Woche hätten die mittlerweile 3.800 in Osttimor
stationierten
Soldaten der Interfet die Hauptstadt Dili bereits weitgehend
unter Kontrolle.
Am 26. September kündigte Cosgrove an, dass die Interfet jetzt
ihre Präsenz Schritt
für Schritt über die Stadtgrenzen von Dili hinaus auf
das ganze Gebiet
ausdehnen werde. Er forderte zugleich auch die vermutlich nach
Westtimor ausgewichenen
Milizen dazu auf, ohne Waffen nach Osttimor zurückzukehren,
um sich zusammen mit den Befürwortern der Unabhängigkeit
am Aufbau
des neu zu gründenden Staates zu beteiligen. Da die regulären
indonesischen Truppen schneller als ursprünglich geplant aus
Osttimor abzögen,
fehle den Milizen künftig die Unterstützung durch die
ehemalige Besatzungsmacht.
Deshalb sei nun auch für die Milizen die Zeit der Vernunft
angebrochen.
Internationalen Beobachter gehen davon aus, dass der Interfet noch
wirklich harte
Zeiten bevorstehen. Die Teile der indonesischen Armee, die in den
letzten Tagen
das zuvor 24 Jahre lang besetzte Gebiet verliessen, haben bei
ihrem Abzug all
das noch abgebrannt und zerstört, was die Milizen zuvor
übriggelassen
hatten. Kaum jemand zweifelt daran, dass die abziehenden
Militärs
ihre langjährigen Schützlinge, die Milizen, mit Waffen
und Munition
beliefern werden, um der Interfet das Leben schwer zu machen.
Bei jedem Schritt, den die Interfet und die Unamet, der zivile Arm
der UN-Mission,
über Dili hinaus tut, zeigt sich, dass die von den proindonesischen
Milizen und der Armee angerichteten Zerstörungen im
gesamten Territorium
viel schlimmer sind, als je vermutet wurde, und dass viel
mehr Osttimoresen vertrieben oder umgebracht wurden, als die
ausländische Öffentlichkeit je hatte wahrhaben wollen.
Die Unamet hat die Zahl
derjenigen, die in der Zeit nach dem Referendum für die Unabhängigkeit
Osttimors vom
proindonesischen Terror aus ihren Unterkünften vertrieben
worden waren,
inzwischen mit 400.000 bis 500.000 angegeben (ursprüngliche
Gesamtbevölkerung
etwa 850.000 Menschen). Hinter diesen Zahlen verbirgt sich
Grauenerregendes.
Die UNO und ausländische Hilfsorganisationen sind bisher
davon ausgegangen,
dass der grösste Teil der Vertriebenen sich in gebirgige
Waldgegenden
versteckt hatte. Nach Aufklärungsflügen, bei denen nirgendwo
die vermuteten
Konzentrationen von in den Bergen kampierenden Vertriebenen
gesichtet worden
waren, gehen die Unamet-Vertreter jetzt davon aus, dass
rund 500.000 Menschen verschwunden sind. Über deren Verbleib
können vorläufig
nur Spekulationen angestellt werden: Entweder sind sehr viel mehr
Osttimoresen
als bisher angenommen massakriert worden, oder viel mehr als
die bisher genannten
200.000 Menschen sind nach Westtimor verschleppt worden.
Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Mary Robinson, hat
bereits die Einsetzung
einer enschenrechtskommission für Osttimor gefordert.
(FR 31.08. & 10.09.99; SZ 02., 06., 16., 17., 24.09.99; NZZ
02.,09., 11./12., 13., 24., 27. & 28.09.99; PIR 17.09.99; PNB
September 1999; Asiaweek 17.09. & 01.10.99)
INHALT
WESTPAPUA:
INTERNATIONALES ROTES KREUZ IM ZWIELICHT
Zur Beendigung
einer im Frühjahr 1996 laufenden Geiselnahme soll die
indonesische
Armee einen Helikopter mit den Markierungen des Internationalen
Roten Kreuzes
(IRK) benutzt haben. So berichtete der australische Fernsehsender
ABC im Juli in seiner Sendereihe "Four Corners". Bei diesem
Täuschungsmanöver
waren acht Personen getötet und viele andere verwundet
worden. Die Aktion
im Mai 1996 sollte zur Befreiung von Geiseln führen, die
seit vier Monaten von Angehörigen der Organisation für
ein freies Papua (OPM)
festgehalten worden waren. Unter den Geiseln befanden sich der
Deutsche Frank
Momberg, vier Engländer, zwei Holländer und mehrere
Indonesier.
Das Internationale Rote Kreuz hatte wochenlang den Kontakt zu den
Entführern gehalten
und die Geiseln per Hubschrauber mit Medikamenten und anderen
lebensnotwendigen
Gütern versorgt. Dabei hatte das IRK ein Vertrauensverhältnis
zu den Entführern aufgebaut und über die Freilassung
der Geiseln verhandelt.
Wie in der Sendung "Blood on the Cross" berichtet wird,
waren die Dorfbewohner bei der Aktion im Mai mit einer Flagge des
IRK
zunächst angelockt und dann beschossen worden. Ausserdem wurde
nachgewiesen,
dass eine Einheit des britischen Special Air Service die indonesischen
Truppen beraten
und die Geiselbefreiung geplant hatte. Die Briten hatten
hierzu hochspezielles
Gerät zur Verfügung gestellt. Behauptungen, dass an
der Aktion Söldner
der südafrikanischen Organisation "Executive Outcome"
teilgenommen
haben sollen, wurden indessen vom ehemaligen Leiter der Organisation,
Nick Van Den Bergh, dementiert. Er bestätigte, dass er zum
damaligen Zeitpunkt
mit einem Team von fünf Soldaten in Westpapua gewesen
sei, um indonesische
Soldaten auf die Geiselbefreiung zu trainieren, bestritt
jedoch, mit seinen Leuten an der Aktion selbst teilgenommen zu
haben.
Die Menschenrechtsorganisation ELS-HAM mit Sitz in Jakarta hat inzwischen
Präsident
Habibie zu einer Stellungnahme aufgefordert.
(Sydney Morning Herald 13.07.99; VEM Mitarbeiterbrief 9/99)
INHALT
FIDSCHI:
TOTE NACH FLUGZEUGABSTURZ
Bei einem Flugzeugabsturz
auf den Fidschi-Inseln sind Ende Juli 17 Personen ums
Leben gekommen. Es war das bisher schlimmste Unglück der Luftfahrt
in der
Geschichte Fidschis. Die Maschine der Fluggesellschaft Air Fiji
zerschellte an
einem Berg rund 70 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt
Suva. An Bord
der Unglücksmaschine waren nach Angaben der Fluggesellschaft
15 Passagiere
und zwei Besatzungsmitglieder.
Das Flugzeug des brasilianischen Typs Bandeirante war 15 Minuten
nach dem Start
vom Regionalflugplatz Nausori abgestürzt. Es hatte sich auf
dem Weg zum
internationalen Flughafen Nadi an der Ostküste der Hauptinsel
Viti Levu befunden.
Der Absturzort liegt in einem sehr abgelegen und unwegbaren
Gebiet. Selbst
die Landung eines Rettungshubschraubers war nicht möglich.
(NZZ 26.07.99)
INHALT
KANAKY:
37 MILLIONEN US-DOLLAR FÜR BEGINNENDEN MACHTTRANSFER
Zur Realisierung
des Ende vergangenen Jahres unterzeichneten Übergangsstatutes
hat das französische Parlament in seinem Jahresetat 2000
einen Posten
von 37 Millionen US-Dollar ausgewiesen.
Das Reglement des von der Bevölkerung Neukaledoniens mit grosser
Mehrheit
angenommenen Statuts soll das Territorium zunächst zu stärkerer
Autonomie und
in 15 bis 20 Jahren zur vollen Selbstständigkeit führen.
Der allmähliche Machttransfer
von Paris nach Noumea wird zunächst insbesondere in Bereichen
wie Aussenhandel,
Bergbau, Gesundheits- und Bildungswesen zum Tragen kommen.
Seit Juni dieses Jahres hat das Territorium eine erste eigene
Regionalregierung.
Im September wurde zudem ein eigener Senat ins Amt berufen.
(PIR 20.09.99)
INHALT
TONGA,
NAURU & KIRIBATI: AUFNAHME IN DEN KREIS DER VEREINTEN NATIONEN
Der Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen (UN) hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen,
die Republiken Kiribati und Nauru sowie das Königreich Tonga
in den Kreis seiner Mitglieder aufzunehmen.
In einer im Juli abgehaltenen Sitzung billigte der Rat die Aufnahme
der Republik Kiribati, stellte jedoch den Antrag Naurus nach Intervention
der chinesischen Delegierten zunächst zurück. Nauru pflegt
diplomatische Beziehungen zu Taiwan, der von China als "abtrünnig"
bezeichneten Inselrepublik. Bei einer zweiten Sitzungsrunde erklärten
sich die Vertreter Chinas zur Aufnahme Naurus bereit, auch wenn
sie die Empfehlung als solche nicht gutheissen könnten.
Auf Empfehlung des Rates soll neben Kiribati und Nauru auch das
Königreich Tonga UN-Mitglieder werden. Tonga hatte Ende vergangenen
Jahres diplomatische Beziehungen zur Regierung in Peking aufgenommen
und somit einen Fürsprecher im Sicherheitsrat gewonnen. Langjährige
Beziehungen zu Taiwan waren abgebrochen worden.
Die Aufnahme der drei Länder in den 185 Mitglieder umfassenden
Staatenbund muss formell noch von der UN-Generalversammlung bestätigt
werden. Aus dem Pazifik gehören ihm neben Australien und Neuseeland
auch Länder wie Papua-Neuguinea, Vanuatu, die Salomonen, Fidschi,
Samoa, die Marshall-Inseln, Palau sowie die Föderierten Staaten
Mikronesiens an.
(Independent 29.07.99; PNB August 99)
INHALT
AUSTRALIEN:
HOWARD BEDAUERT UNRECHT AN DEN ABORIGINES
Der australische
Regierungschef John Howard hat sich dem jahrelangen Druck der Öffentlichkeit
gebeugt und Ende August offiziell bedauert, was den Ureinwohnern
in der Vergangenheit angetan worden ist. In einer Erklärung
vor dem Parlament bekundete er ein "tiefes und aufrichtiges Bedauern
gegenüber den Ureinwohnern", während er jedoch weiterhin
das Wort "Entschuldigung" vermied. Aus diesem Grund gaben sich die
oppositionelle Labor Party und einige Aborigines mit der als historisch
gewerteten Erklärung nicht zufrieden.
Dennoch kann sie als wichtiger Schritt in den Verhandlungen zwischen
der sogenannten "gestohlenen Generation" und der Regierung über
eine offizielle Entschuldigung gewertet werden. Bis in die sechziger
Jahre hinein waren Kinder von Ureinwohnern aus ihren Familien gerissen
worden, um sie von Weissen grossziehen zu lassen. Bei ihnen sollten
sie lernen, sich in der australischen Mehrheits-Gesellschaft zu
assimilieren. Viele wurden jedoch nur als billige Arbeitskräfte
missbraucht. Howard hatte in den vergangenen zwei Jahren lediglich
eine persönliche Entschuldigung angeboten.
(SZ 27.08.99)
INHALT
AUSTRALIEN:
AUSSENPOLITISCHE PLÄNE DES PREMIERS KRITISIERT
Mitte September
hat der australische Premierminister John Howard die Aussenpolitik
seiner Regierung neu definiert und damit eine heftige Debatte ausgelöst.
In einem später abgegebenen Interview machte der Regierungschef
deutlich, wie
er sich Australiens neue Aussenpolitik vorstellt. Demnach soll
in Zukunft persönlichen
Beziehungen zwischen politischen Führern verschiedener
Länder weniger Gewicht beigemessen werden. Statt dessen sollen
nationale Interessen
in den Vordergrund rücken und unterschiedliche
Wertvorstellungen respektiert werden.
Australien müsse, so Howard, als westliche Nation im asiatischen
Raum mit starken
Verbindungen zu Europa und den USA anerkannt werden. Überlegungen,
wie genau Australien
mit Asien verbunden sei, sind seiner Ansicht nach überholt.
So sei das nationale Interesse jetzt in erster Linie auf
australische
Werte abzustützen, während die Beziehungen beispielsweise
zu Indonesien
nicht "ungeachtet aller Kosten" zu pflegen seien. Die Pflege der
Allianz mit den
USA bleibe prioritär. Zudem müsse Australien die
Verteidigungsausgaben wesentlich erhöhen.
Kritiker werfen Howard vor, Australiens Aussenpolitik der fünfziger
Jahre übernommen
zu haben. Sie befürchten, dass in der asiatisch-pazifischen
Region die Vorstellung,
Australien werde als Stellvertreter der USA die Rolle
eines Polizisten in Asien übernehmen, Antipathien neu aufleben
lassen könnte.
Seit der Führungsrolle Australiens im Osttimor-Konflikt haben
zumindest die Beziehungen zu Indonesien bereits einen Tiefpunkt
erreicht.
(NZZ 28.09.99)
INHALT
AUSTRALIEN:
"AYERS ROCK" ERHÄLT SEINEN EINHEIMISCHEN NAMEN "ULURU" ZURÜCK
"Ayers Rock",
Markenzeichen Australiens, hat seinen einheimischen Namen
"Uluru" ("schattenspendender
Platz") zurückerhalten. Der seit dem 19.
Jahrhundert als "Ayers Rock" bezeichnete Fels war mit einer 1948
eröffneten
Naturstrasse zum Ziel einer lawinenartig anschwellenden Zahl von
Schaulustigen
geworden, die das Spektakel des bei Sonnenuntergang dramatisch
erglühenden
Berges anzog. Den Ureinwohnern, die nach Auswertung von Felsmalereien
seit mindestens 5.000 Jahren in Symbiose mit dem Berg leben,
war dessen Herabwürdigung
zum Tummel- und Rummelplatz ein Greuel. 1958 schuf die
australische Regierung auf zynische Weise Abhilfe: Sie nahm Ayers
Rock und
die nahen 36 Felsbuckel des Mount Olga den Ureinwohnern weg, erklärte
sie zum Schutzgebiet und siedelte die Ureinwohner nach Möglichkeit
aus. 1977
avancierte das Schutzgebiet zum Nationalpark. Hotels, Motels, Zelt-
und Parkplätze
mussten jetzt wenigstens die Parkgrenze respektieren.
Der jahrelange Kampf der Ureinwohner um ihren Berg endete schließlich
mit durchschlagendem
Erfolg. 1985 ging der Rechtstitel am Parkland an die Aborigines
über, die das Land im Gegenzug der Bundesregierung für
99 Jahre verpachteten.
Gleichzeitig nahmen sie mit einer Mehrheit in dem Gremium
Einsitz, das
den Park verwaltet und betreibt.
In diesen Wochen haben der Berg und die umliegenden Felsen ("Kata
Tjuta", viele
Köpfe) ihre einheimischen Namen zurückerhalten. Beim Namenswechsel
blieb es nicht.
Für Besucher resultierten neue Einschränkungen. So sind
einige Stellen
des Berges tabu, und an Festtagen, an denen grosse Rituale
die schöpferische
"Traumzeit" ins Jetzt und Hier holen, ist der Park geschlossen.
Neben Verboten haben die Aborigines aber noch mehr bewirkt. Ihr
in Jahrtausenden
akkumuliertes ökologisches Wissen soll dem Park künftig
zugute kommen.
Der Park erlangte bereits 1987 den Status als Weltkulturerbe, damals
als sogenanntes
Naturgut. 1994 würdigte das Welterbekomitee den Park als
Kulturlandschaft
und als unvergleichliche "assoziative Landschaft".
Als eine Art feierliche Wiederinbesitznahme des Berges durch die
Ureinwohner soll
am 8. Juni 2000 das olympische Feuer bei Uluru landen und von
Stammesführern
rund um den Berg getragen werden.
(NZZ 08.09.99)
INHALT
KIRCHLICHE
NACHRICHTEN
Papua
Neuguinea
ALTBISCHOF
GAM ÜBER UMWELTSCHÄDEN DURCH BERGBAU
Altbischof Sir
Getake Gam hat in seiner Kolumne in der Wochenzeitung Wantok in
die erneut aufgeflammte öffentliche Diskussion um die von der
Bergbauanlage
Ok Tedi verursachten Umweltschäden eingegriffen.
Der Minenbetrieb habe den Menschen der Western Province grosse Probleme
gebracht mit
Auswirkungen auf den Lebensstil, die Lebensqualität,
Auswirkungen
im geistigen und geistlichen Bereich. Im Interesse einer
positiven Entwicklung
im Lande und von der trügerischen Hoffnung auf Reichtum
verführt hätte die Regierung die Genehmigungen für
den Gold- und Kupferabbau
erteilt. Schon die Wissenschaftler des deutschen Starnberger
Instituts hätten in ihrer Untersuchung auf die kommenden Schäden
hingewiesen.
Nach einer Besichtigung vor Ort hätten die Vertreter des Rats
der Kirchen von
PNG sich an den damaligen Premierminister Sir Rabbie Namaliu
gewandt, jedoch
ohne Erfolg. Nun habe sich gezeigt, dass die Auswirkungen
viel dramatischer
sind und die technischen Möglichkeiten des Menschen
überfordern.
So werden die bleibenden Folgen des Bergbaus in der Western
Province als abschreckendes Beispiel zu sehen sein, gleichsam als
Mahnmal dafür,
dass ähnliches in anderen Teilen des Landes nicht geschehen
darf. In der
Region Wau / Bulolo (Morobe Province) habe sich seit Beendigung
des industriellen
Goldabbaus bis heute der Boden nicht regeneriert, immer noch
fehle es dort
an Gartenland und Waldflächen. So habe sich Premierminister
Sir Mekere Morauta
nun viel zu spät mit der Bitte um Hilfe an die Weltbank
gewandt, das
hätte Sir Rabbie Namaliu bereits tun sollen.
"Wir haben am Beispiel Ok Tedi gelernt," so der Altbischof, "dass
die Ausbeutung
der Bodenschätze uns nicht wirklich helfen kann." So sollte
die Regierung
zu allererst an das Wohl der Bevölkerung denken, bevor sie
Investoren aus
Übersee ins Land kommen lässt. Auch müssen die Pläne
der Firmen
zur Entwicklung der natürlichen Umwelt im Auswirkungsbereich
der Anlagen
vor Erteilung von Genehmigungen genau begutachtet werden und später
ihre Implementierung
überwacht werden. Sollte dies bei anderen
Bergbauanlagen in PNG gegenwärtig nicht der Fall sein, so sollten
die Firmen gezwungen
werden, ihren Betrieb solange einzustellen, bis diese Voraussetzungen
erfüllt sind.
(Wantok 09.09.99)
INHALT
VOR
100 JAHREN: DIE ERSTE TAUFE DURCH NEUENDETTELSAUER MISSIONARE
Am 20. August
1899, 13 Jahre nach Beginn der Tätigkeit des ersten Missionars
Johann Flierl,
wurden zwei Schüler, Kaboeng und Kamungsanga, auf die
Taufnamen Tobias
und Silas von Missionar Georg Pfalzer getauft. Nach der Taufe
sind die beiden Erstgetauften in ihre Dörfer zurückgekehrt,
um, wie es in
einem ersten Bericht heisst, "in ihrer heidnischen Umgebung als
Salz zu wirken,
als Licht zu leuchten, wider alles heidnische Unwesen zu zeugen".
Aus den kleinen Anfängen ist inzwischen eine Kirche erwachsen,
die mit ungefähr
einer Million Mitgliedern die grösste evangelische Kirche im
Pazifik ist.
Dass das Evangelium so angenommen wurde, ist vor allem zurückzuführen
auf die vielen einheimischen Evangelisten und ihre Familien,
die in oft unwegsamen
Bergen und Tälern zu Zeugen Christi an ihren eigenen
Landsleuten wurden.
Unterstützt wurden sie dabei von weit über 350
Missionaren, Missionarinnen und ihren Familien, die im Laufe der
Jahre von Neuendettelsau
ausgesandt wurden. Zusammen mit Mitarbeitenden der lutherischen
Kirchen aus Australien und Amerika sowie der deutschen Missionswerke
in Leipzig und Nordelbien haben sie oft unter schweren Bedingungen
ihren Dienst getan. Heute sind mehr als 90 % der
Gesamtbevölkerung von ca. 4,5 Millionen getauft.
(Gernot Fugmann, Zeit für Mission 2/99)
INHALT
BISCHOF
KIGASUNG: KEIN GRUND ZUR PANIK: DIE KIRCHE WÄCHST!
Trotz finanzieller
Probleme ist die ELC-PNG lebendig und gut beieinander, so
ihr Leitender
Bischof Dr. Wesley Kigasung bei den Feierlichkeiten aus Anlass
der ersten Taufe
vor 100 Jahren. Auch andere Kirchen, das gesamte Land und
viele Staaten
der Erde befänden sich gegenwärtig in finanziellen Nöten.
Er sei
mit grosser Freude erfüllt, weil trotz aller Probleme die Kirche
weiterhin stetig
wachse. Immer mehr gebildete und erfolgreich im Leben stehende
Mitglieder sähen auch ihre finanzielle Verantwortung für
die Kirche.
(Post Courier Online 22.07.99)
INHALT
MS
DOULOS BEGEISTERT EMPFANGEN
Am 12. September
fährt das Schiff MS Doulos mit seinem evangelistischen
Buchangebot für
eine Woche nach Bougainville in besonderer Mission. Dort
gibt die Besatzung
des internationalen Schiffes Schulbücher kostenlos an die
Schulen der Insel
aus. Zusammen mit den Kirchen von Bougainville veranstalten
sie ausserdem Gebetsgemeinschaften und Bibelarbeiten. Das
Schiff wird in
Buka und Loloho anlegen. Bereits 1990 war das Schiff trotz
der Bürgerkriegs-Kämpfe
nach Bougainville gekommen.
Tausende besuchten nun das Schiff der christlichen Bücher während
der ersten Tage
in Lae. Die Besucher kamen aus der Stadt, aber auch aus der gesamten
Morobe-Provinz
sowie aus dem Inland. Wegen des Beginns der Schulferien wird
ein weiterer
Ansturm erwartet: die Besucher besichtigen das Schiff und
schauen sich
insbesondere die Ausstellung christlicher Literatur an. Die
internationale
Besatzung bietet ausserdem ein evangelistisches Rahmenprogramm
mit Beiträgen aus vielen Kulturen der Welt. Für Personen
über 16
Jahre kostet der Eintritt 50 Toea.
Das Schiff Doulos wurde vor 85 Jahren gebaut und hält damit
den Rekord unter den
in Betrieb befindlichen Passagierschiffen. Die 300 Mitglieder der
Besatzung stammen
aus 35 Ländern. Unter ihnen befinden sich 20 Familien mit
30 Kindern. In
den vergangenen 21 Jahren hat das Schiff in 86 Staaten der
Welt angelegt.
Es führt in seiner "Buchmesse" 600.000 Bücher von 6.000
unterschiedlichen
Titeln mit sich.
(PC Online 28.09.99 und Wantok 02.09.99)
INHALT
PNGCC:
DEN OPFERN DER FLUTWELLE VON AITAPE GEHT ES SCHLECHTER ALS ZUVOR
Nach einem Besuch
in der Region von Aitape bei den Opfern der Flutwellenkatastrophe
des vergangenen Jahres haben sich die Generalsekretärin
des Rats der Kirchen von PNG (PNGCC), Sophia Gegeyo, und
Rev. Ken Kushachi
von der United Church of Christ in Japan besorgt an die Öffentlichkeit
gewandt. Immer noch hätten vier Notaufnahmelager keinen
Strassenanschluss, zudem sei die neu gebaute Strassenverbindung
von Aitape nach
Barupu nicht wetterfest. Derzeit werden mit einem Zuschuss von über
250.000 Kina
aus ökumenischen Mitteln sechs Schulhäuser, sechs Wohnhäuser
für Lehrerfamilien,
eine Erste-Hilfe-Station sowie die Wasserversorgung für
das Aufnahmelager
Wipom gebaut. An die politisch Verantwortlichen gewandt forderte
Frau Gegeyo u.a., dass erneut medizinisches Personal zur
Nachbetreuung
in die Lager geschickt wird. Die Lage der Betroffenen solle
durch gezielte
landwirtschaftliche Beratung und durch die Rücksiedlung der
Familien in feste
Häuser verbessert werden.
(National 13.09.99 nach PIR 15.09.99)
INHALT
PNGCC:
PNG-REGIERUNG SOLL SICH FÜR FRIEDEN AUF OSTTIMOR EINSETZEN
Der Rat der
Kirchen von PNG (PNGCC) hat mit Nachdruck die Regierung von PNG
aufgefordert,
sich gegen das Morden in Osttimor zu wenden. "Wir bitten
darum, dass PNG
unverzüglich eine Kampagne zur Wiederherstellung des
Friedens auf
Osttimor startet." Unterdessen hat sich auch die Caritas (PNG)
eingeschaltet
und bei der Regierung von PNG dafür plädiert, den Flüchtlingen
aus Osttimor
Asyl zu gewähren.
(Independent 09.09.99)
INHALT
LUFTPIRATEN
ENTFÜHREN MISSIONSFLUGZEUG
Ein Flugzeug
des internationalen Missionswerks "Missionary Aviation Fellowship"
(MAF) ist in Papua-Neuguinea entführt worden. Am 28. August
übernahmen
fünf Luftpiraten eine Maschine vom Typ Twin Otter mit 14
Passagieren an
Bord am Kopiago-See im Südlichen Hochland. Die Entführer
bedrohten die
Mannschaft mit Schusswaffen und Messern. Alle Insassen wurden
ausgeraubt. Die
Luftpiraten zwangen den Piloten, zu einer Landestelle knapp
40 Kilometer
südwestlich von Kopiago zu fliegen. Dort flohen sie aus der
Maschine. Der
Pilot startete sofort wieder, um Passagiere und Mannschaft in
Sicherheit zu
bringen. Von den Mitreisenden wurde niemand verletzt. Ein
Flugbegleiter
erlitt allerdings bei einer Auseinandersetzung mit den Entführern
eine 20 Zentimeter lange Schnittwunde im Rücken. Von den Tätern
fehlt jede Spur.
MAF ist als nichtkommerzielles Unternehmen mit 170
Flugzeugen in 26 Ländern aktiv. Die Organisation fliegt Personal,
Versorgungsgüter
und Medikamente zu Missionsstationen. Die deutsche MAF-Zentrale
befindet sich in Wienhausen bei Celle.
(idea 30.08.99)
INHALT
ERZBISCHOF
FÜR ENTWAFFNUNG AUF BOUGAINVILLE
Der katholische
Erzbischof und frühere Administrator der Kirche auf
Bougainville,
Karl Hesse, hat gefordert, den Waffenbesitz in der Inselprovinz
stärker zu kontrollieren. "Diese Waffen sind eine Bedrohung
für die
Gesellschaft. Wir geben die Unantastbarkeit der Person auf, wenn
wir uns der
Herrschaft der Schusswaffen unterwerfen", so der Erzbischof. "Die
Waffen müssen
aus der problematischen Situation der Insel verschwinden, sie
bedrohen die
Menschen." Weil die politischen Gruppierungen bewaffnet seien,
bedeute dies
auch ständigen Druck auf die Familienangehörigen der
Betroffenen.
(Post Courier Online 27.09.99)
INHALT
AUSEINANDERSETZUNG
UM KONDOME
Als zu einseitig verwarf die Katholische Bischofskonferenz in einer
Stellungnahme
die von Dr. Mola während eines Seminars in Lae über sexuell
übertragbare
Krankheiten (STD) vertretene Empfehlung, schon Kinder mit der
Benutzung von
Kondomen vertraut zu machen. Mola hatte über die Auswirkungen
von HIV, AIDS
und anderen STDs auf die Wirtschaft des Landes und auf die
gesellschaftliche
Struktur gesprochen. Im Hinblick auf manche Länder in
Afrika wies er
darauf hin, dass gerade die arbeitsfähige Altersgruppe
zwischen 20 und 35 Jahren bedroht sei. Der Generalsekretär
der Bischofskonferenz,
Lawrence Stephens, unterstellte der Presse, sie werfe der
Kirche vor, den
Menschen nicht zu einem besseren Leben verhelfen zu wollen.
Dagegen Stephens: dies treffe nicht zu, aber auch junge Menschen
müssten über
die Gefahren ungeschützten und häufig wechselnden Geschlechtsverkehrs
aufgeklärt
werden und ihnen müssten zu allererst die Werte von Ehe und
Familie vermittelt
werden. Die Diskussion um Verhütungsmittel werde schon
jahrelang geführt,
da würde die Kirche ihren Standpunkt nicht über Nacht
verändern.
(Post Courier Online 24.09.99)
INHALT
KATHOLISCHE
BISCHÖFE ÜBER GEWALT GEGEN FRAUEN
Bischof Stephen
Reichert, der Vorsitzende der Katholischen Bischofskonferenz
von PNG und den
Salomonen, wies auf die ständig wachsende Zahl der Fälle
von Vergewaltigungen
und Gewalt gegen Frauen hin. Er verurteilte dies scharf,
zumal PNG sich
als ein den christlichen Prinzipien verpflichtetes Land verstehe.
Dabei bezog er sich auf einen Zwischenfall, der sich am vergangenen
Wochende in einem Frauenkloster in Goroka ereignet hatte. Die
Täter seien bekannt und würden in Kürze gefasst.
Die Gläubigen forderte der Bischof
auf, für die Opfer zu beten und solche Vorkommnisse nicht
gleichgültig
hinzunehmen. Er forderte Polizei und Politiker auf, verstärkt
für den
Schutz der Frauen im Land zu sorgen.
Rund um die Uhr sucht die Polizei von Goroka nach den Tätern,
die eine katholische
Ordensschwester vergewaltigt und vor zwei Wochen eine andere mit
Messerstichen
verletzt hatten. Den Angaben der Polizei zufolge seien die
Bewohner des
Stadtteils Nord-Goroka, wo sich die Zwischenfälle ereignet
hatten, nicht
sehr kooperationsbereit.
(Wantok 16.09.99 und Post Courier Online 21.09.99)
INHALT
ERZBISCHOF
BARNES: REGIERUNG MUSS MISSSTÄNDE BESEITIGEN
Aus Anlass der
diesjährigen Unabhängigkeitsfeierlichkeiten hat der
Erzbischof von
Port Moresby, Brian Barnes, erneut an die neue Regierung
appelliert, mit
geeigneten Schritten die vielen Probleme des Landes anzupacken.
So müsse das Präferenz-Wahlsystem wieder eingeführt
werden, um Wählerstimmenkäufe
zu verhindern. Der Missbrauch des Mehrparteiensystems, vor
allem dass die Parteizugehörigkeit nach der Wahl gewechselt
würde ohne Rücksicht
auf das Mandat der Wählerschaft, müsse mit einer Neufassung
des
Parteiengesetzes verhindert werden. Wenn es der Regierung wirklich
an der Entwicklung
an der Basis gelegen ist, dann müsse der Verfügungsgeldfonds
der Parlamentarier
(Electoral Development Fund, Fonds zur Entwicklung im Wahlkreis)
abgeschafft werden. Die 'Unabhängige Kommission gegen Korruption'
müsse wieder
ins Leben gerufen werden. Der Öffentliche Dienst müsse
gegen politisches
Taktieren geschützt werden, die Zahl der Angehörigen des
Öffentlichen
Dienstes müsse sinnvoll reduziert werden mit dem Ziel der
Qualitätsverbesserung (Qualität statt Quantität).
Entwicklungsfördermittel müssten
nachweisbar zu Erfolgen führen, so werde das Vertrauen ausländischer
Geldgeber in
die Regierung PNGs gestärkt. Im Hinblick auf die Katholiken
auf Bougainville
(rund 80% der Bevölkerung) forderte der Erzbischof die
Regierung auf,
die Rehabilitationsmassnahmen auf der Insel zusammen mit der
Katholischen
Kirche durchzuführen.
(Wantok 16.09.99)
INHALT
BISCHOF
REICHERT GEGEN SCHUSSWAFFEN IM SÜDLICHEN HOCHLAND
Hunderttausende
von Menschen litten unter den ethnischen Auseinandersetzungen
in der Region, so der katholische Bischof von Mendi, Stephen
Reichert. Drei Monate Nichtstun könne dazu führen, dass
schliesslich das
totale Chaos im Südlichen Hochland ausbricht. So appellierte
er an die Regierung,
unverzüglich zu handeln.
Bischof Reichert wies darauf hin, dass über 200.000 Menschen
in den westlichen
Wahlkreisen der Provinz von anderen Landesteilen abgeschnitten
seien. Die Öffentlichen
Dienste seien dort wegen der Spannungen nach dem Tod des
früheren Gouverneurs Dick Mune im Mai des Jahres eingestellt
worden.
Vermutlich sei man sich auf Landesebene nicht bewusst, dass die
Region ernsthaft
darunter leidet, dass so viele Waffen im Umlauf sind. Bischof
Reichert sprach
am Dienstagabend über den Rundfunksender in der Provinz und
forderte Frieden,
Harmonie und Respekt vor dem Gesetz. Statt auf Aktionen der
Regierung zu warten, sollten die Menschen sofort selbst die Initiative
ergreifen und
die zerstrittenen Parteien zusammenführen, um den Frieden und
gegenseitiges
Verstehen zu fördern. Bereits Anfang August hatte er hat in
einem offenen Brief die Politiker des Südlichen Hochlands und
die aus der Region
stammenden Parlamentsabgeordneten aufgefordert, sich für Frieden
und Entwicklungszusammenarbeit
in der Provinz einzusetzen.
(Post Courier Online 02.09.99 und Wantok 05.08.99)
INHALT
ANGLIKANISCHE
KIRCHE: NEUE SENDEREIHE
"Kirche unterwegs
in das Jahr 2000" heisst die neue Sendereihe der Anglikanischen
Kirche, die ab dem 14. August jeweils sonntags von Radio
Karai von 19:30
Uhr bis 20:00 Uhr ausgestrahlt wird. Die Sendungen sind eine
Reaktion auf
Prediger in den Strassen, die den Leuten Angst vor der Jahrhundertwende
machen und vom zweiten Kommen Christi und dem Ende der Zeiten
reden. Bischof Michael Hough von der Diözese Port Moresby,
der Initiatior
der Sendereihe, möchte auf diesem Wege den Menschen das
Evangelium bringen.
"Jeder redet über die Macht des Satans, aber niemand
möchte über
das Gute reden, das Gott getan hat." In den Sendungen soll auch
über Tagesthemen
im Licht des Evangeliums gesprochen werden.
(Independent 02.09.99)
INHALT
UNITED
CHURCH: NEUER BISCHOF FÜR NEW BRITAIN
Die 30.000 Mitglieder
der United Church in der Region New Britain haben einen
neuen Bischof. Es ist Rev. Isikel Tioty. Er stammt aus dem Dorf
Takubar im Kreis
Viviran (East New Britain Province). Bislang war Rev. Tioty
Superintendent
im Kirchenkreis Kabakada (bei Rabaul) sowie der Repräsentant
des Bischofs
für die Provinz. Gewählt wurde er kürzlich während
der 7.
Synodaltagung der United Church von New Britain. Seine Amtseinführung
wird im
nächsten April stattfinden. Dann wird Rev. Tioty Bischof Nasain
Waisale ablösen.
Rev. Tioty war von den 109 Delegierten der Synode unter insgesamt
sechs Kandidaten
gewählt worden, die von den 49 Kirchenkreisen nominiert
worden waren.
Mit 42 Jahren ist er der jüngste Geistliche, der in der United
Church in das
Bischofsamt gewählt worden ist. Tioty ist verheiratet und hat
sechs Kinder.
In einem Interview mit dem Post Courier hob der zukünftige
Bischof vor allem
die missionarischen Aufgaben der Kirche im neuen Jahrtausend
hervor. Ausserdem wolle er die Einheit in der Kirche stärken
und so
auch dem Schafe Stehlen durch die Sekten begegnen.
(Post Courier Online 01.09.99)
INHALT
Pazifik
RELIGIONEN
UND RELIGIONSFREIHEIT IM PAZIFIK
Literaturhinweis:
Die Abteilung für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit
des U.S.Department
of State hat am 9. September 1999 einen neuen Bericht über
die Religionsfreiheit in den Staaten der Welt herausgebracht. Er
trägt den
Titel 'Annual Report on International Religious Freedom for 1999'
und enthält
auch Informationen über die Kirchen und Religionsgruppen in
den Ländern
des Pazifik.
Im Internet einsehbar unter:
http://www.state.gov/www/global/human_rights/irf/irf_rpt/1999/
(Eigene Meldung 21.09.99)
INHALT
CHRISTINNEN
BAUEN REGIONALES NETZ AUS
Mehr als 300
Frauen aus Australien, den Salomonen, Neuseeland, Samoa und PNG
hielten eine
viertägige Konferenz in Port Moresby ab. Die Veranstaltung,
die zeitlich
mit der Jugendkonferenz des Süd-Pazifik zusammenlag, war von
der Evangelical
Fellowship of the South Pacific veranstaltet worden. Margaret
Sete, die Leiterin
der Frauenkonferenz, sagte, es sei dies das erste Mal gewesen,
dass sich Frauen aus den verschiedenen Konfessionen in der Region
getroffen haben,
um Gedanken auszutauschen und die bestehenden Verbindungen zu stärken.
Das Thema "persönliche Fürbitte" wollte den Frauen handfeste
biblische Grundlagen über Gebet vermitteln. Gastrednerin war
die Dozentin Marlyn
Rowsome vom Christian Leaders' Training College in Banz (Westliches
Hochland).
(Post Courier Online 31.08.99)
INHALT
AMERIKANISCH-SAMOA:
RELIGIÖSE SENDUNGEN JETZT LIVE
Mit einer neuen Satelliten-Schüssel können nun auch aktuelle
christliche Fernsehsendungen
aus dem Festland und dem benachbarten Samoa (Westsamoa) in
Amerikanisch-Samoa
übernommen und live ausgestrahlt werden. Die American
Samoa Cablevision
(ASC) übertrug bislang auf dem Kanal 23 Sendungen von
Trinity Broadcasting
Network (TBN) und Graceland Broadcasting Network (GBN).
Die Sendungen waren jedoch bei Ausstrahlung schon mehrere Wochen
alt, denn sie
wurden per Band vom Festland oder von Samoa aus mit dem Schiff nach
Amerikanisch-Samoa
gebracht.
(PIR 20.09.99 nach Samoa News 14.09.99)
INHALT
AUSTRALIEN:
AUTOBIOGRAFIE JOHANN FLIERLS JETZT AUF ENGLISCH
Gerade rechtzeitig
zur Hundertjahrfeier der ersten Taufe in Neuguinea wurde
die Autobiografie
des Pioniermissionars Johann Flierl fertiggestellt. Ins Englische
war das Werk von Johann Flierls Enkel Erich übersetzt worden.
Im Rahmen
eines Festgottesdienstes übergab der Präsident der Lutherischen
Kirche von Australien
(LCA), Dr. Lance Steike, ein Exemplar dem Leitenden Bischof
der Evang.-Lutherischen Kirche von PNG, Dr. Wesley Kigasung. Das
255 Seiten
starke Buch trägt den Titel: Johann Flierl - My life and God's
Mission (Mein Leben und Gottes Mission). Es wurde vom Verlag Open
Book herausgebracht
und ist für 14.95 AUSD in Australien erhältlich.
(Mission Panorama August 99)
INHALT
FIDSCHI:
KIRCHEN GEGEN PLUTONIUM-TRANSPORTE
Nicht-Regierungsorganisationen
und Kirchen in Fidschi haben gemeinsam in einer
am 11. August in der Fiji Times veröffentlichten Anzeige die
Regierung des
Landes aufgefordert, den beiden aus Europa nach Japan fahrenden
Schiffen mit
Plutonium-MOX-Brennstoff die Fahrt durch Fidschi-Gewässer zu
verbieten.
Während eine Delegation von britischen, französischen
und japanischen Vertretern
der Atomindustrie und der Aussenministerien die Durchfahrt von
Dutzenden weiterer
Transporte auch mit anderen Staaten, wie den Salomonen, den
Föderierten Staaten von Mikronesien und Belau, aushandeln will,
forderten die
Unterzeichner der Anzeige einen sofortigen Stopp aller Atomtransporte
durch den Südpazifik.
(PIR 12.08.99 nach einer Presseerklärung des Pacific Concerns
Resource Centre und Greenpeace vom 11.08.99)
INHALT
FRANZÖSISCH-POLYNESIEN:
EVANGELISCHE KIRCHE FÜR MUTTERSPRACHE UND BEFREIUNG VON FRANKREICH
Die 115. Synode
der Evangelischen Kirche von Französisch-Polynesien
diskutierte die
Rolle der Tahiti-Sprache und das Konzept der Befreiung bei
den Maohi (indigene
Tahiti-Bevölkerung). Der Rat der Kirche, der in Pape'ete
tagte, betonte
die Bedeutung der einheimischen Sprache bei der Vermittlung
von Wissen und
Weisheit. Sie sei ein Mittel des polynesischen Volkes, sich
Anerkennung und
Gehör zu verschaffen. Der Rat wies auf die Probleme hin, die
Menschen ohne
Französisch-Kenntnisse bei Gericht hätten. Die
Kirchenvertreter forderten von der französischen Regierung,
dass es diesen Menschen
gestattet sein sollte, sich selbst in ihrer Muttersprache zu
verteidigen.
Auch für den innerkirchlichen Sprachgebrauch plädierte
der Kirchenpräsident
Jacques Ihorai für die einheimische Sprache: statt Brot und
Wein sollte man
'uru' und 'Kokosmilch' sagen.
Auf der Tagesordnung stand auch der Vorschlag für ein Austauschprogramm
zwischen den
verschiedenen regionalen Kirchen mit Hilfe des Rats der Kirchen
des Pazifik,
z.B. ein Pfarreraustausch mit Neukaledonien.
Unter dem Stichwort "Befreiung" wurde eine weitgehende Autonomie
des Staates von
Frankreich diskutiert.
Der Rat der Kirche verabschiedete sodann den Haushalt für das
Finanzjahr 1998-1999
in Höhe von 268 Mio. Franz.-Pazifik-Francs (2,68 Mio USD).
"Wir sind
nicht reich, aber grosszügig", so der Kirchenpräsident
Ihorai, "Ich habe
sogar die Pfarrer gebeten, nicht zu rauchen, denn auch die
Zigarettenkäufe
werden letztlich vom Geld unserer Mitglieder finanziert."
Die Gemeinden der Evang. Kirche von Französisch-Polynesien
haben rund 95.000 Mitglieder
(geschätzt) und 69 Pfarrer. Die Einwohnerzahl des Landes
insgesamt wird
mit rund 200.000 angegeben.
(PIR 13.08.99 nach PINA Nius vom 12.08.99)
INHALT
KIRIBATI:
CHRISTEN UND AIDS
Der Gesundheitsminister
von Kiribati, Baraniko Mooa, sagte auf einer Tagung des
Nationalen Kirchenrats von Kiribati, dass Christen in besonderer
Weise den
staatlichen Gesundheitsdienst bei der Pflege von HIV/AIDS-Patienten
ergänzen
könnten. Den Christen komme eine besondere Rolle bei der Vorbeugung
zu, indem sie
die Gemeinden an ihren Glauben und an die Grundsätze
christlicher
Lebensführung erinnerten.
Nach Mooa ist die Zahl der AIDS-Patienten in Kiribati seit 1991
von zwei auf 28
angewachsen. Diese Menschen brauchten die Unterstützung durch
Christen besonders,
da sie mit vielfältigen Problemen konfrontiert seien, bis hin
zur Suizidgefährdung.
(PIR 13.09.99 nach pacnews 09.09.99)
INHALT
SALOMONEN:
BISCHOF RUFT ZUM FRIEDEN AUF
Der katholische
Erzbischof des Salomonen, Adrian Smith, hat öffentlich dazu
aufgefordert,
die ethnisch begründeten Spannungen im Interesse der leidenden
Bevölkerung
beizulegen. Die gegnerischen Parteien dürften nicht mit dem
Finger aufeinander
zeigen. Die Frist zur Niederlegung der Waffen sei am 2.
September verstrichen ohne dass Waffen abgegeben worden seien. Die
Kämpfer im
Versteck sollten nach Hause gehen und sich am Wiederaufbau beteiligen.
Mit seinem Appell
unterstützte der Bischof auch eine Stellungnahme des
Premierministers
der Salomonen, Ulufa'alu.
(Wantok 09.09.99 und Independent 09.09.99)
INHALT
|