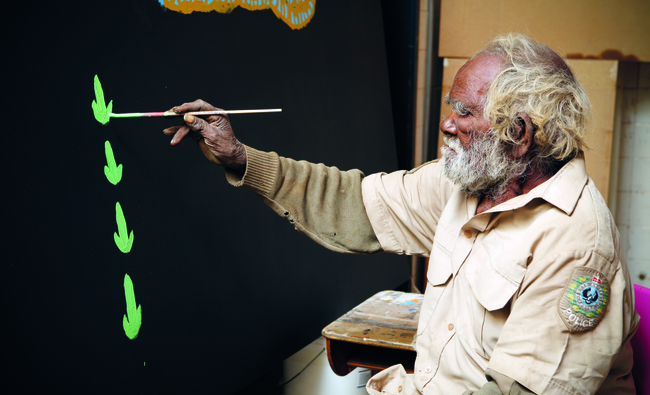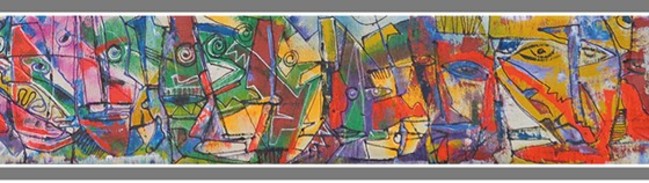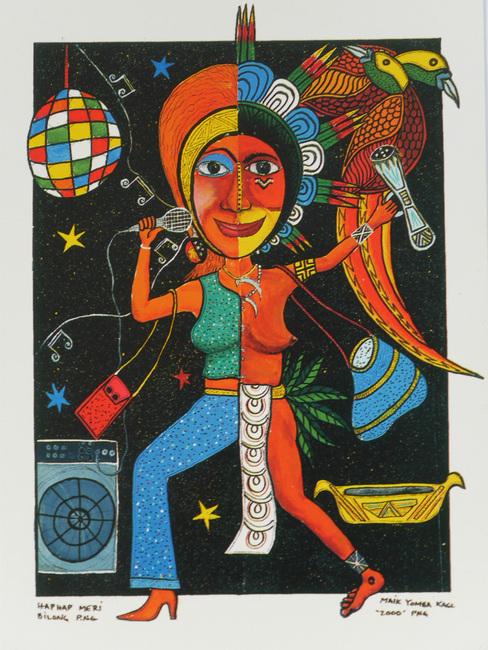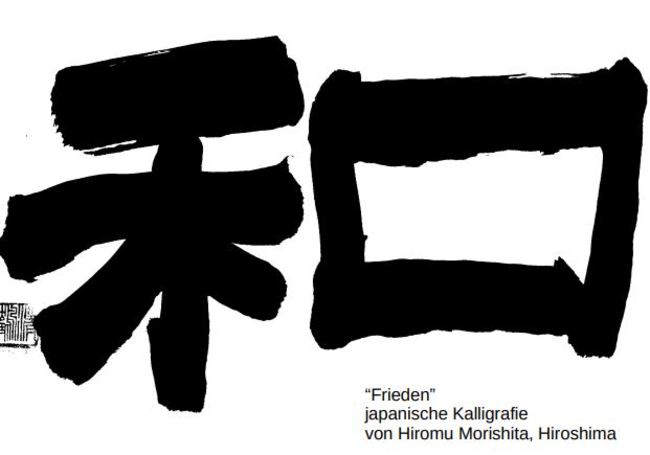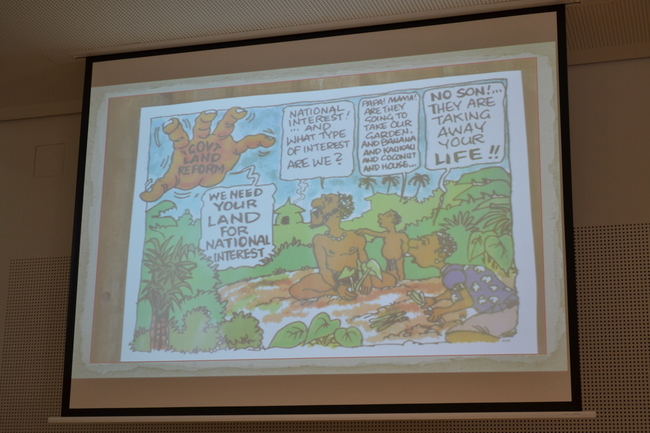Hintergrund - Klimawandel
Informationen zu den Auswirkungen der weltweiten Klimaveränderung im Pazifik
Veranstaltungshinweis:
Am Samstag, 5. Februar 2005, veranstaltet das Pazifik-Netzwerk von 9:00 bis 18:00 Uhr ein Fachseminar zum Klimawandel in Remagen bei Bonn. Das Programm wird demnächst veröffentlicht!
Klimawandel und Meeresspiegelanstieg- Folgen im tropischen Pazifik
Es gibt immer deutlichere Hinweise darauf, dass Menschen, insbesondere in den Industrienationen, durch ihr Verhalten das Klima beeinflussen. In den letzten 100 Jahren, also einem Zeitraum, für den kontinuierliche Messungen in vielen Gebieten der Erde vorhanden sind, ist die Temperatur im globalen Mittel bereits um etwa 0.6°C angestiegen. Dieser Anstieg lässt sich mit Hilfe von Klimamodellen auf die durch von Menschen verursachte Emissionen bedingte Zunahme verschiedener Treibhausgase wie Kohlendioxid und Methan zurückführen.
In diesem Zeitraum ist auch der mittlere Meeresspiegel bereits um 10 bis 20 cm (1 -2 mm pro Jahr) gestiegen. Die große Unsicherheit in dieser Zahl lässt sich damit erklären, dass es nur wenige Messpunkte für die Meereshöhe auf der Welt gibt, die kontinuierlich seit über 100 Jahren betrieben werden. Außerdem erfolgt der Meeresspiegelanstieg genau wie der Temperaturanstieg nicht gleichmäßig, und im Gegensatz zur Temperatur gibt es keinen festen Bezugspunkt, da sich auch die Küste, an der die Messung erfolgt, z.B. durch tektonische Vorgänge heben oder senken kann. Auch der Anstieg des Meeresspiegels lässt sich mit Hilfe von Klimamodellen nachvollziehen. Den größten Anteil hat dabei die thermische Ausdehnung des Meerwassers. Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus, und da die Meere in einem gewissen Rahmen feste seitliche Grenzen haben, führt dies zuerst zu einem Anstieg der Meeresoberfläche. Weitere Faktoren können das Abschmelzen von Gletschern und Inlandeis (Grönland, Antarktis) sowie das Schmelzen von Permafrostböden und andere Änderungen im Wasserkreislauf sein, nicht aber das Abschmelzen vom Meereis, da dieses die gleiche Menge Wasser verdrängt, aus der es besteht.
Da man mit Modellen, in die man alle bekannten Ursachen für den Meeresspiegelanstieg 'hineinfüttert', aber einen geringeren Anstieg erhält als tatsächlich gemessen wird, kann man davon ausgehen, dass noch nicht alle Prozesse bekannt sind, die zum Anstieg beitragen. Dies führt auch dazu, dass die Computer-Modelle, mit denen Klimavorhersagen erzeugt werden, den Meeresspiegelanstieg eher unter- als überschätzen.
Zur Erstellung solcher Vorhersagen benötigt man Annahmen über die zukünftige Entwicklung der von Menschen verursachten Treibhausgas-Emissionen. Da diese z.B. von der Entwicklung der Bevölkerungszahlen und der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung abhängen, haben Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler über 40 mögliche Verläufe der Treibhausgas-Emissionen für die nächsten 100 Jahre entwickelt, sogenannte Szenarien. Diese reichen von Szenarien mit ungebremster Entwicklung und sehr hohen Emissionen bis zu anderen mit stark regulierter Entwicklung und schnellem technologischen Fortschritt, der schon bald eine deutliche Verringerung der Emissionen bringen könnte. Mit Hilfe dieser Szenarien werden Klimamodelle angetrieben, die die Klimaentwicklung unter den bekannten Bedingungen bis heute gut wiedergeben. Die so gewonnenen 'Klimavorhersagen' decken eine große Bandbreite der möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung ab, und es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen verschiedenen Klimamodellen. Allen gemeinsam ist jedoch ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um mindestens weitere 1.5°C, möglicherweise aber auch über 4°C. Und in letzter Zeit gibt es sogar vermehrt Hinweise darauf, dass diese Schätzungen eher zu niedrig als zu hoch sind.
Der daraus resultierende Meeresspiegelanstieg liegt im globalen Mittel bei 48 cm (je nach Szenario und Modell 9cm bis 88cm), siehe Abbildung 1. Mit Hilfe komplizierter Modelle wurde der Anteil der verschiedenen Ursachen am Meeresspiegelanstieg ermittelt. Danach werden 27 cm (11cm bis 43cm) durch thermische Ausdehnung verursacht, 12 cm (1cm bis 23cm) durch das Abschmelzen von Gletschern und 4 cm (2cm Absinken bis 9cm Ansteigen) durch das Abschmelzen von grönländischem Festlandeis.
Der Einfluss der Antarktis würde dabei eher zu einem Absinken des Meeresspiegels um 8 cm (17cm Absinken bis 2cm Ansteigen) führen. Dieses mögliche Absinken käme dadurch zustande, dass in einem wärmeren Klima mehr Wasserdampf in der Luft wäre, und dadurch mehr Niederschlag fallen würde. In der Antarktis ist es aber fast überall so kalt, dass eine leichte Erwärmung die Temperaturen nicht über den Gefrierpunkt heben kann. Der größere Niederschlag ohne Verstärkung des Abschmelzens führt dann zu einem Anwachsen der Eisdecke, und damit einem Absinken des Meeresspiegels. Würden dagegen alle Gletscher / das Grönlandeis / die Antarktis völlig abschmelzen, käme es zu einem Anstieg des Meeresspiegels um 50cm / 7,2m / 61,1m.
Eine gefährliche, wenn auch sehr unwahrscheinliche Situation könnte eintreten, wenn große Teile des antarktischen Schelfeises abschmelzen. Dabei handelt es sich zwar um Meereis, das den Meeresspiegel nicht beeinflusst, das Abschmelzen könnte aber zu einer Instabilität des westantarktischen Festlandeises führen. Dieses liegt zwar auf dem Festlandsockel, hat ihn aber durch sein Gewicht soweit heruntergedrückt, dass er unterhalb des Meeresspiegels liegt, und dadurch kann das Eis eventuell abrutschen, wenn das Schelfeis es nicht mehr hält. Dieser Effekt könnte zu einem Anstieg des Meeresspiegels von ca. 7 m führen.
Außer bei einem solchen Ereignis würde der Meeresspiegel allerdings sehr langsam ansteigen, und ein weiterer Anstieg könnte auch noch über Jahrtausende erfolgen, nachdem sich die Treibhausgaskonzentration und die Lufttemperatur stabilisiert haben. Solch ein langsamer Anstieg wäre für gesunde Korallenriffe in den pazifischen Atollen eigentlich kein Problem. Bisher ist man davon ausgegangen, dass sie einfach mitwachsen können. Inzwischen gibt es aber Anzeichen, dass die Erwärmung des Meeres sowie auch der Anstieg der Kohlendioxidgehaltes die Korallen so schädigen, dass sie doch nicht mitwachsen können. In sehr warmem Wasser stoßen nämlich die Korallen die bunten Algen ab, die auf ihrer Oberfläche leben und ihnen Nährstoffe geben. Dieses 'Bleichen' der Korallen geht zwar in vielen Fällen wieder zurück, wenn die Temperatur erneut sinkt, führt aber in anderen Fällen auch zum Absterben der Korallen oder schwächt sie zumindest. Hinzu kommt die Übersäuerung des Oberflächenwassers durch den hohen Kohlendioxidgehalt der Luft (Kohlensäure), die den Aufbau der Kalkskelette behindert. Ein Absterben der Riffe, die als Lebensraum für viele Fischarten dienen, würde einerseits die natürliche Artenvielfalt gefährden, und andererseits der Bevölkerung die wichtigste Nahrungsquelle nehmen. Außerdem wären die Inseln selbst ihrer natürlichen Wellenbrecher beraubt.
Zusätzlich dazu sind sehr flache Inseln natürlich auch durch einen Anstieg des Meeresspiegels direkt gefährdet. Einzelne sehr flache, unbewohnte Inseln, die bis vor einigen Jahren noch begehbar waren, sind bereits heute überflutet, z.B. in Tuvalu. Auch die landwirtschaftlich genutzten Böden und die Süßwasservorkommen sind stärker durch eine Versalzung gefährdet. Für Atolle ist die sogenannte Süßwasserlinse die einzige Trinkwasserquelle. Sie besteht aus einer flachen Süßwasserschicht, die innerhalb des Inseluntergrundes auf dem vom Meer eindringenden Salzwasser schwimmt, und ist daher sehr empfindlich gegenüber einem steigenden Meeresspiegel und Sturmfluten.
Aber auch höher gelegene Inseln sind von Sturmfluten, die von einem höheren Meeresspiegel ausgehen, bedroht. Hinzu kommt, dass eine Verstärkung der tropischen Stürme durch die höheren Temperaturen und den dadurch höheren Wasserdampfgehalt der Luft sehr wahrscheinlich ist. Außerdem sind in den letzten Jahren einige sehr intensive El Niño Wetterlagen aufgetreten, in denen die Stürme, die sonst eher die australische Küste erreichen, ihre Zugbahn verändern und sich vermehrt über den Inselstaaten 'austoben'. Diese Wetterlage bringt außerdem zwischen den Stürmen weniger Niederschlag, und gefährdet damit wiederum die Süßwasserversorgung vieler Inseln. Einige Klimamodelle zeigen eine verstärkte Tendenz zu El Niño in einem wärmeren Klima.
Obwohl die Bewohner der Inseln traditionelle Anpassungsmethoden an extreme Wettersituationen haben, könnten sie doch bei einer weiteren Veränderung des Klimas schnell an die Grenzen der Anpassungsfähigkeit stoßen. Andere Maßnahmen, wie die Verlagerung der Siedlungen, das Anfüllen einzelner Inseln auf Kosten anderer z.B. unbewohnter Inseln, der Bau von Meerwasserentsalzungsanlagen und der verstärkte Import von Lebensmitteln sind teuer und kaum finanzierbar, auch weil die Klimaveränderung zu einer geringeren Attraktivität für Touristen und damit zum Verlust einer wichtigen Einnahmequelle führen würde. Im schlimmsten Fall droht die erzwungene Auswanderung, die mit einem Verlust der staatlichen Souveränität und wahrscheinlich auch der traditionellen Kultur verbunden wäre. Dies ist um so schlimmer, da diese Inselstaaten selbst wenig gegen die Ursachen des Klimawandels tun können. Sie produzieren nur weniger als 1% der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen und sind damit auf die Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes der Industrienationen angewiesen.
(Die Informationen stammen zum allergrößten Teil aus dem dritten Bericht des IPCC (Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press), Beiträge der Arbeitsgruppen I und II. Dieser Bericht ist in englischer Sprache vollständig im Internet verfügbar hier.
Dr. Susanne Nawrath, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
Vortrag für das Pazifik-Netzwerk e.V. am 28.6.2003 in Berlin